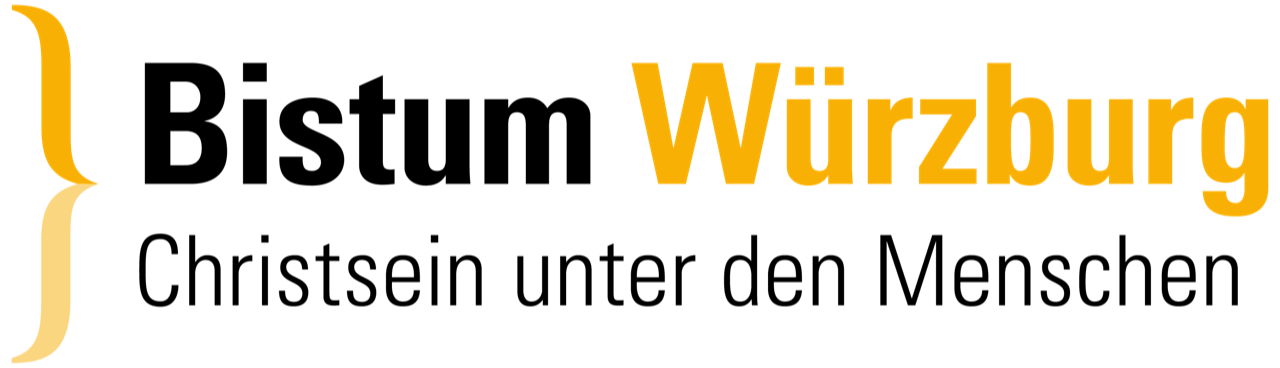Dieser Papst „vom Ende der Welt“, wie er sich selbst bei seiner Wahl nannte, hat die Kirche ordentlich durcheinandergewirbelt. Schon die Wahl des Erzbischofs von Buenos Aires, Kardinal Jorge Mario Bergoglio, am 13. März 2013 war eine Überraschung. Genauso wie sein Name als Papst: Franziskus. Ein Gigant unter den Heiligen, ein Name, der für ein herausforderndes Programm steht. Papst Franziskus wurde diesem Anspruch gerecht. Er brach mit Traditionen, wohnte statt in der großen Papstwohnung in einem einfachen Appartement im vatikanischen Gästehaus, ließ barocke Spitzengewänder im Schrank, trug ausgetretene schwarze Schuhe statt feiner roter Lederschuhe.
Vor allem aber wandte sich Franziskus wie sein Namenspatron den Armen und einfachen Menschen zu. Er wollte seine Kirche an die Ränder führen und lebte vor, wie das geht. Er aß mit Obdachlosen, umarmte Menschen und ließ sich umarmen, holte Flüchtlinge nach Rom, wusch Gefängnisinsassen die Füße. Zuletzt besuchte er am Gründonnerstag ein Gefängnis. Eine seiner ersten Reisen führte ihn, das Kind italienischer Einwanderer, nach Lampedusa. Die Mittelmeerinsel steht wie kaum eine zweite für das Flüchtlingsdrama an den europäischen Außengrenzen. Immer wieder setzte er sich für Flüchtlinge ein, zuletzt in einem scharfen Brief an die US-amerikanischen Bischöfe, in dem er Donald Trumps Massenabschiebungen kritisierte.
Franziskus war ein politischer Papst, der sich für Klimaschutz, interreligiösen Dialog und Frieden einsetzte. Vor der Klagemauer in Jerusalem umarmte er einen Imam und einen Rabbi. Politikern küsste er im Werben für Frieden die Füße. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine verließ er den Vatikan, um in der russischen Botschaft um Frieden zu bitten. Leider vergeblich. Bei vielen Themen war Franziskus klar. Beim Umgang mit Flüchtlingen. Oder bei seiner Kritik an Waffenproduzenten oder dem Kapitalismus: „Diese Wirtschaft tötet.“ Beim russischen Angriff auf die Ukraine blieb er aber oft unklar. Es dauerte, bis er die russische Aggression eindeutig verurteilte.
„Zu Beginn meines Pontifikats hatte ich das Gefühl, dass es von kurzer Dauer sein würde: Ich dachte, vielleicht drei oder vier Jahre, nicht mehr“, schrieb Franziskus in seiner kürzlich veröffentlichten Autobiografie. Dann wurden es zwölf Jahre mit vier Enzykliken, vier Weltjugendtagen, Reisen in mehr als 60 Länder. Seine Heimat Argentinien hat er übrigens nie wieder gesehen, seitdem er im Frühjahr 2013 den Flieger zum Konklave nach Rom bestiegen hatte.
Bis zuletzt hat sich dieser Papst kaum geschont. Er machte keinen Urlaub und absolvierte trotz starker Erkältung offizielle Termine. Diese Erkältung entwickelte sich zu einer schweren Infektion und Lungenentzündung. Wochenlang musste Franziskus im Krankenhaus behandelt werden. Nun schien er wieder da zu sein. Doch sein Auftritt zu Ostern – der Segen mit schwacher Stimme und eine Rundfahrt mit dem Papamobil durch die Pilgermenge – war kein Neuanfang, sondern sein Abschied.
Dieser Abschied war so außergewöhnlich wie Franziskus selbst. Er war ein mutiger Papst. Unvergessen seine Ansprache an die Kardinäle, in der er den obersten Führern der Weltkirche spirituelle Krankheiten attestierte. So herzlich er zu einfachen Menschen war, so schroff konnte er zu seinen eigenen Leuten sein. Mut bewies er auch, als er sich auf eine Synode zur Familie einließ und danach Wege aufzeigte, wie wiederverheiratet Geschiedene doch zur Kommunion gehen können. Über das Thema wird heute kaum noch diskutiert. Franziskus hatte eine pastorale Lösung gefunden, ohne das Kirchenrecht oder die Lehre zu ändern.
Dann die große Synode zur Synodalität. Ein Herzensprojekt, das er noch rechtzeitig abschließen konnte. Bei der Synode debattierten nicht mehr nur Bischöfe und Kardinäle unter sich. Nichtgeweihte Laien, darunter auch Frauen, waren stimmberechtigte Mitglieder. Für konservative Kritiker stand Franziskus für zu viel Öffnung. Den Reformern ging er nicht weit genug. Behutsam wollte er die Kirche reformieren, mit Gesten Vorbild sein, aber auch keine Spaltung provozieren.
Auch beim Personal ging Franziskus an die Ränder
Welchen Weg die Kirche nun gehen wird, ist derzeit kaum auszumachen. Von den 135 wahlberechtigten Kardinälen hat Franziskus 108 ernannt, davon nur 40 aus Europa. Auch bei diesen Personalentscheidungen ist Franziskus an die Ränder gegangen. So machte er den Bischof von Tonga im Südpazifik zum Kardinal, während Bischöfe von traditionell mit der Kardinalswürde verbundenen Diözesen in Europa leer ausgingen. Aber nur, weil ein Kardinal von Franziskus ernannt wurde, muss er nicht für seinen Weg einer pastoralen Öffnung und großzügigen Praxis stehen. Seine letzte Ruhe wird Papst Franziskus nicht im Vatikan finden, sondern in Santa Maria Maggiore, jener Marienkirche Roms, die er immer wieder aufsuchte – nach seiner Wahl zum Papst, vor und nach Reisen und bei einer Bittwallfahrt während der Corona-Pandemie.
Spätestens 20 Tage nach dem Tod des Papstes ziehen sich die Kardinäle in die Sixtinische Kapelle zurück, um einen Nachfolger zu wählen. Auf diesen warten schwere Zeiten – schließlich ringt die Kirche um ihren Weg in der modernen Welt, um Öffnung oder Abwehr. Und angesichts der politischen Krisen braucht die Welt mehr denn je eine moralische Instanz und einen Verkünder des Glaubens, der Hoffnung geben kann.
Ulrich Waschki